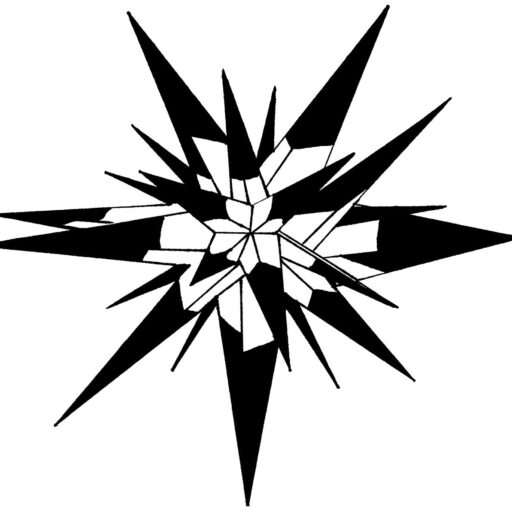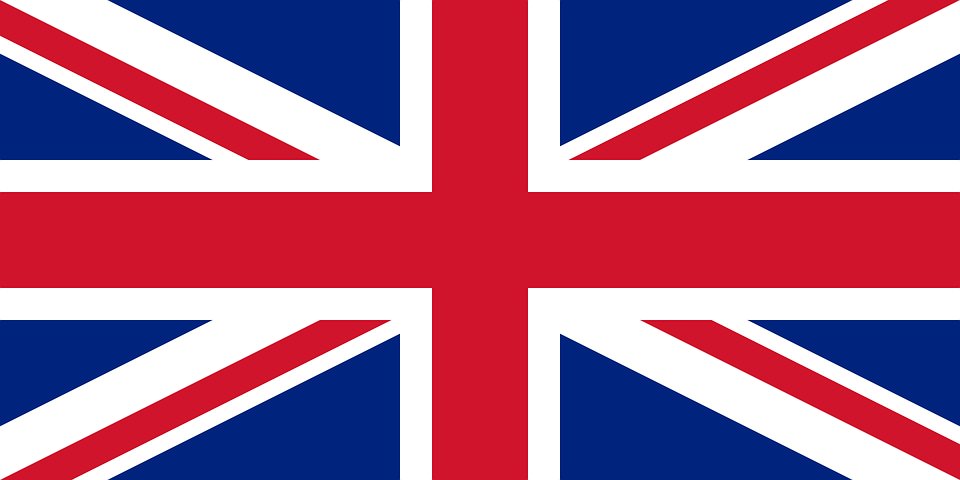Hier veröffentlichen wir Interviews, die auch mit Quellenverweisen und Zusatzinformationen in unserem Jahrbuch zugänglich sind. Den Anfang macht das Interview mit Dr. Bastian Ronge aus der zweiten Nummer unseres Jahrbuchs (2024).
Über Mentoring im Fach Philosophie
Ein Gespräch mit Dr. Bastian Ronge über Möglichkeiten und Wirklichkeiten materialistischen Philosophierens in Academia.
„Vieles von dem, was Universität vorgibt zu leisten, leistet Universität gar nicht selber, sondern passiert in außeruniversitären Räumen.“
„Der ideologische Diskurs der Universität bietet Begriffe an, die, wenn man sich mit ihnen reflektiert, einen dazu bringen, sich selber als unzureichendes Mitglied der Lebensform Universität wahrzunehmen. Deswegen muss auf die begriffliche Reflexion und die Durchdringung von begrifflichen Zusammenhängen gesetzt und gefragt werden, was das mit einem selber zu tun hat. Das ist, finde ich, eine sehr demokratische Praxis.“
„Eine materialistische Art und Weise zu Philosophieren ist für die Aufnahme eines Studiums durchaus geeignet, weil die materialistische Art und Weise des Philosophierens etwas mit dem Leben zu tun hat, das die Studierenden führen, weshalb die philosophische Praxis etwas sein muss, was nicht nur im Seminarraum in der Universität als ein Inhalt, oder als eine Technik, oder als eine Kompetenz wahrgenommen wird, sondern als etwas, das etwas mit dem eigenen Wahrnehmen und Denken und Reflektieren macht.“

Prager Gruppe*: Wie ist das philosophische Mentoring-Programm entstanden und wozu ist es gut?
Dr. Bastian Ronge: Wie es entstanden ist, kann ich beantworten. Wozu es gut ist, wird schwieriger zu beantworten sein. Im Zuge der Bologna-Reform hat sich auch in der deutschen Hochschullandschaft der Gedanke durchgesetzt, dass die Studieneingangsphase eine besondere Phase des Studiums ist, die maßgeblich darüber entscheidet, ob Studierende zu Ende studieren oder nicht. Im Rahmen des „Qualitätspakt Lehre“ gab es verschiedenste Projekte, die darauf abzielten, die Studieneingangsphase zu verbessern und zum Teil verstetigt wurden. Im Kontext dieses Prozesses habe ich eine Ausschreibung von der Bergischen Universität Wuppertal gesehen und mich darauf beworben und landete so im mentoriellen Zusammenhang im Fach Philosophie.
Wozu es gut ist, ist vielleicht schon durchgeklungen. Das Mentoring soll helfen, die Studieneingangsphase derart zu gestalten, dass Studierenden einen besseren Weg ins Studium der Philosophie finden. Wenn man sich mit der Forschung zur Studienereignisphase beschäftigt, gibt es verschiedene Diskurse. Einer davon stammt aus den Sozialwissenschaften und konzentriert sich vor allem auf Universität als Institution der Chancengleichheit sowie Bildungsgerechtigkeit. In diesem Kontext stößt man schnell auf die Beobachtung, dass die Studieneingangsphase für Studierenden sehr unterschiedlich ausfällt, je nachdem, welche soziale Herkunft sie mitbringen und welchen Habitus sie dadurch haben. Mit Pierre Bourdieu und dem Konzept des Habitus kann man dann analysieren und darstellen inwiefern es zu dem kommt, was Theoretiker:innen Habitus-Struktur-Konflikte nennen. Mit diesem Konzept kann man beschreiben, analysieren, erklären, wie und warum manche Studierenden besser ins Studium finden und andere schlechter. Das Mentoring hat die Aufgabe, so verstehe ich das zumindest, diesen Gap zu schließen oder besondere Angebote bereitzustellen, um Habitus-Struktur-Konflikte zu bearbeiten.
PG*: Erstens, gelingt das? Und zweitens, beschränkt sich das Mentoring auf die Studieneingangsphase oder bleibt der Bedarf auch darüber hinaus bestehen? Der Begriff ‚Studieneingangsphase‛ klingt ja ein bisschen so nach Orientierungswoche im ersten Semester – ‚Hallo, Leute, hier die Mensa, dort die BiB, so funktioniert Moodle‛. Sicher ist das so nicht gemeint und es stellt sich die Anschlussfrage, ob sich Deine Aufgaben im Mentoring vielleicht sogar über den gesamten Zeitstrahl des Bachelor-Studiums erstrecken und vielleicht sogar bis in das Masterstudium durchziehen?
Dr. BR: Studieneingangsphase ist formal definiert als die ersten zwei Semester. ‚First Year‛ heißt das im angelsächsischen Kontext. Aber es wird schnell klar, und das merke ich auch in der Arbeit, dass so komplizierte Prozesse wie die Bewältigung von Habitus-Struktur-Konflikten natürlich länger dauert als ein oder zwei Semester. Deren Bearbeitung ist sehr voraussetzungsreich und eine delikate Angelegenheit, die vom Subjekt, von den Studierenden eine Bereitschaft voraussetzt, sich auf solche Prozesse einzulassen. Ich hatte zum Beispiel ein Seminar mit dem Titel: ‚Was ist Universität?‛ Da ging es um eine Reflexion der Institutionen sowie des Studiums an sich. Die Veranstaltung war für das erste Semester geöffnet, jedoch haben sich kaum Studierende hineinverirrt. Die, die es gewagt haben, waren Universitätswechsler, die also schon Erfahrung mit der Universität gemacht hatten und deswegen überhaupt erst auf die Frage angesprungen sind. Deswegen würde ich völlig zustimmen: Man kann diese Art von mentoriellen Prozessen nicht auf ein oder zwei Semesterzeiträume begrenzen; die mentorielle Dimension zieht sich durch ein ganzes Studium und wird wahrscheinlich an allen Sollbruchstellen auch immer wieder akut; sei es der Abschluss Bachelor, sei es der Abschluss Master, sei es der Abschluss Promotion.
Während der Studierendenphase gibt es die meisten Verluste bei Erstakademiker:innen. Der Bildungsbericht 2024 ist ja auch erst ein paar Wochen alt und zeigt, wie Erstakademiker:innen sukzessiv aus dem System gespült werden. Gerade hier tut sich seit Jahrzehnten wenig. Aus Nicht-Akademiker-Elternhäusern schafft es von 100 einer, die Doktorarbeit zu beenden; und aus Akademikerhaushalten, sechs bis acht. Das ist auf jeden Fall eine sehr signifikante Spannweite, die bislang tatsächlich nicht geschlossen werden konnte.
PG*: Kannst Du so einen Begriff wie ‚Habitus-Struktur-Konflikt‛ ein bisschen plastisch machen? Vielleicht Beispiele nennen, um zu verdeutlichen, worum es da geht?
Dr. BR: Ein Habitus-Struktur-Konflikt kann man plastisch machen, indem man sich (wieder mir Bourdieu) die Universität als ein soziales Feld vorstellt. Dieses Feld konstituiert sich durch die Erwartungshaltung der Akteure, die dieses Feld repräsentieren; in dem Fall sind das Lehrende an der Universität. Diese Erwartungshaltungen sind verknüpft mit dem Habitus dieser Lehrenden. Hier setzt der Habitusbegriff von Bourdieu an. Es geht dabei um die Wahrnehmung und die Bewertung der Wahrnehmung. Bourdieus’ Theorie läuft darauf hinaus, zu sagen, dass darin [in Wahrnehmung und ihre Bewertung, PG*] bestimmte Klassifikationsschemata eingebaut sind, die auf die gesellschaftliche Klassenstruktur verweisen. Das fängt an bei Dichotomien wie ‚oben und unten‛, ‚groß und klein‛, ‚dick und dünn‛ und geht noch viel weiter. In solchen Dichotomien, die bereits normativ aufgeladen sind, nehmen wir die Welt wahr, immer zugunsten einer dieser Unterscheidungskomponenten und zuungunsten der anderen. Das heißt, man hat eigentlich immer eine Verungleichung oder eine Asymmetrisierung in der Wahrnehmung der sozialen Wirklichkeit. Und wenn man dann ein geisteswissenschaftliches Studium wie die Philosophie beginnt, wird man bei den Lehrenden häufig zum Beispiel wahrnehmen, dass sie eine sehr hohe Wertschätzung für Muße haben und eine Geringschätzung für körperliche Tätigkeiten. Eine solche Sicht ist für Studienanfänger:innen, die aus Akademiker-Elternhäusern kommen – sprich aus Elternhäusern, in denen vor allem Kopfarbeit repräsentiert und deswegen auch eine Wertschätzung von geistiger Arbeit kommuniziert wird – sehr viel leichter nachzuvollziehen, als für Studierende, die aus einem Elternhaus kommen, das körperliche Arbeit wertschätzt und wo rein geistige Arbeit vielleicht sogar für ‚Nichts-Tun‛ gehalten wird. Für diese Studierenden ist der Appell ‚Gehen Sie in die Bibliothek und versenken Sie sich in ein philosophisches Buch ihrer Wahl! Genießen Sie die Freiheit der geistigen Aktivität!‛ Worte, mit denen sie nicht unmittelbar etwas anfangen können. Anders als für mancherlei Akademiker:innenkind, das denkt, ‚Ja genau, das Philosophiestudium – das Studium des Wahren, Guten und Pipapo‛.
PG*: Wenn wir es richtigen überblicken, ist dein phiMENT-Programm im deutschsprachigen Raum das erste Mentorenprogramm in der Philosophie und Du bist auch der Erste, der diese Mentoren:innenstelle innehat. Ist das richtig? Zweitens, sofern das so ist, scheint ja tatsächlich ein Bewusstsein für derartige Problematiken entstanden zu sein, aufgrund deren diese Stelle und das Mentoren-Büro überhaupt erst geschaffen wurde. Kann man das so sagen? Gibt es ein Problembewusstsein?
Dr. BR: Nein. Mentoringprogramme gibt es an vielen Universitäten, auch in der Philosopohie. Allerdings setzt es häufig später an, nämlich z. B. in der Promotion- oder Habilitationsphase, häufig auch mit Fokus auf die Benachteiligung von Frauen in der Philosophie bzw. der Universität. An der Wuppertaler Uni ist das phiMENT das erste Mentoring, das in der Philosophie mit Fokus auf die Studieneingangsphase läuft. Die dafür nötigen Gelder gibt es auch an verschiedenen Universitäten, nur gehen die Institutionen damit unterschiedlich um. Häufig konzentriert man sich eher auf die Stärkung der Studienberatung oder tatsächlich die Vermittlung von praktischem Wissen. In der Variante, wie ich es jetzt ausgestaltet habe, kommt es mir, so wie ich das bislang überblicke, relativ singulär vor. Aber das heißt nichts. Bestimmt arbeiten Leute andersdwo ähnlich. Aus den Sozialwissenschaften ist mir zum Beispiel bekannt, dass es da ähnliche Ansätze und Konzeptionen gibt.
Zur zweiten Fragen nach dem entstandenen Problembewusstsein kann ich sagen: Nein, das kann man so nicht sagen. Denn die inhaltliche Ausgestaltung ist mehr oder weniger auf meinem Mist gewachsen und entspricht wie gesagt nicht unbedingt der inhaltlichen Ausgestaltung anderer Mentoringmaßanhmen. Und was ich so erlebe in den Auseinandersetzungen mit anderen Akteuren an Universitäten, ist, dass es ein Gerangel um die Problembeschreibung gibt. Eine gängige Problembeschreibung lautet: ‚Studierende verfügen nicht über die notwendige Studierfähigkeit um eigentlich zu studieren – diese Studierfähigkeit muss ihnen nachholend vermittelt werden‛. Hier wird das Mentoring oder die Studieneingangsphase dazu benutzt, die Studierfähigkeit – das ist ein rein abstrakter Begriff, der unter anderem so eine schwarze Peter-Funktion hat – einzufordern, weil die Schule als Ausbildungsweg versagt habe. Das zielt eher ab – und Bourdieu würde das als einen „Rassismus der Intelligenz“ beschreiben, in den man sich schnell verstrickt, wenn man an so Bildungsinstitutionen arbeitet – auf solche Gedankengänge wie: ‚Die sind zu dumm, zu blöd, zu faul, die wollen nicht, die gucken nur ins Smartphone, früher war alles besser‛. Das ist natürlich selbst eine klassistische Problembeschreibung. Die wird als solche aber nicht erkannt, weil die Akteure an Universitäten zum überwiegenden Teil – gerade in der Philosophie – aus Akademiker:innenelternhäusern stammen. Zwar gibt es noch keine Statistiken dazu; wir haben gerade eine Umfrage durchgeführt; und es hat auch viel mit dem Unterschied zwischen kontinentaler und analytischer Philosophie zu tun – denn es ist so: Der Anteil von Erstakademiker:innen scheint in der analytischen Philosophie größer als in der kontinentalen zu sein. Deswegen tun sich Universitäten, wo analytische Philosophie dominiert, auch weniger schwer damit, einfach sehr pragmatisch zu sagen: ‚Wir müssen den Leuten erst mal bestimmte Sachen vermitteln, denn woher sollen sie es wissen, wenn wir es ihnen nicht sagen?‛
PG*: Das bringt uns ja in komplizierteres Fahrwasser. – Du grenzt Dich also ab von gängigen Konzepten, die noch davon ausgehen, dass in der Ausbildung der Studierenden etwas verpasst worden sei und die die Probleme mit Labels versehen wie Unwillen zu Lesen, Faulheit und Konzentrationsschwierigkeiten. Das sind ja Klagen, die man immer wieder hört. Aber es ist gerade nicht das Konzept oder die Perspektive, die Du hast. Das heißt, Du hast ein alternatives Konzept, das den inhärenten Klassismus in diesen Aussagen oder Perspektiven in gewisser Weise zu bekämpfen vorhat; zugleich stößt Du damit in der akademischen Welt, im sozialen Feld Universität, nicht auf dieselbe Anerkennung wie Mentoren:innenbüros, die jetzt in dem Sinne operieren, wie Du es eben geschildert hast, und von denen Du dich abgrenzt.
Dr. BR: Das kommt sehr darauf an, wer in den Universitäten an welchen Positionen sitzt und wie bereitwillig sie sind, die Dimension Klassismus zu reflektieren. Meine Erfahrung ist, dass das tatsächlich sehr personenabhängig ist. Wenn man einen Blick in die USA wirft, sieht man, dass Universitäten eine total andere Politik fahren bezüglich der First-Gen-Thematik [englisch für Erstakademiker:innen, PG*]. Nämlich nicht so, dass sie versuchen, ihre hohe Zahl an First-Gen zu verschleiern. Die gehen damit offensiv um und etablieren Welcome Center für First-Gen-Studierenden, um ihnen die bestmögliche Unterstützung zu geben. Die sehen sie als Arbeitskräfte von morgen und verstehen sich als Institutionen, die sie ausbilden müssen. Ganz pragmatisch gemäß dem Motto: ‚Was brauchen die, was muss man ihnen geben, was muss man ihnen sagen?‛.
Ich habe mich in die sogenannte ‚Difference Education‛ noch nicht eingelesen. Aber in psychologischen Studien kann man empirisch nachweisen – und es ist immer sehr wichtig, dass man irgendwelche Sachen empirisch nachweisen kann, wenn man solche Argumentationsmuster in Institutionen vorbringen will –, dass es den Studiererfolg erhöht, wenn Studierende zu Beginn ihres Studiums darüber aufgeklärt werden, dass soziale Herkunft auch ein Vorteil sein kann, weil die Leute im Grunde flexibler sind und andere Sachen sehen. Und wenn sie erkennen, dass diese Differenz im Grunde eine Ressource ist und keine Blockade, ändert das schon sehr viel daran, wie sie studieren. Insofern wäre meine Prognose, wenn ich eine abgeben müsste oder sollte, dass die deutschen Universitäten sich auf lange Sicht so einen bestimmten bildungsbürgerlichen Dünkel gar nicht mehr leisten können werden, weil die Universität letzten Endes Teil eines kapitalistisch organisierten marktwirtschaftlichen Zusammenhangs ist und daran gemessen wird, ob sie Arbeitskräfte produziert. Da sind die US-Amerikaner qua Kapitalismus sans phrase weiter. Für die ist es überhaupt keine Schwierigkeit, das einfach als ein sachliches Problem anzusehen und dann auch als sachliches Problem wissenschaftlich zu bearbeiten. Was mich ja eher wundert, ist, wie eine wissenschaftliche Institution so relativ unwissenschaftlich mit sich selber umgehen kann, so dass man einfach bestimmte Tatsachen lieber nicht sehen möchte oder nicht in der Offenheit und Wissenschaftlichkeit thematisiert, obwohl der aktuelle Forschungsstand das ermöglichen würde.
PG*: Das hieße, ein offener Umgang mit dem System, das man gemeinhin Kapitalismus nennt, produziert in gewisser Weise eine Form von Antiklassismus an den amerikanischen Universitäten…
Dr. BR: Paradoxerweise würde ich sagen: ja, das stimmt.
PG*: Das ist ja wie im kommunistischen Manifest.
Dr. BR: Ja, der Kapitalismus dampft alles weg, der dampft auch Standesdünkel weg. Das sieht man ja daran, dass amerikanische und englische Professoren:innen kein Berufsstand bilden. Dass wir das [in Kontinentaleuropa, PG*] so haben, ist sozusagen anachronistisch und bringt eine Feudalstruktur in das System rein, die im Grunde unzeitgemäß ist.
PG*: Wenn wir damit jetzt auf den Unterschied zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie kommen und feststellen, dass die Analytiker:innen diese Veränderungen affirmativ mitgehen, weil sie eher als die Kontinentalphilosoph:innen sehen, dass den Leuten von Anfang an bestimmte Basics mit auf den Weg gegeben werden müssen, damit am Ende Abschlüsse produziert werden. Könnte man dann nicht sagen, dass die Art und Weise wie analytische Philosophie in der akademischen Landschaft vermittelt wird, tendenziell weniger klassistisch ist als kontinentale Philosophie? Und unabhängig von der genauen Verortung, wie wirkt sich das auf die Inhalte aus?
Dr. BR: Ich kenne mich schlecht in der Geschichte der analytischen Philosophie aus und bin ja selber auch nicht in der Tradition sozialisiert worden. Es scheint mir aber so zu sein, dass die Geburtsstunde der analytischen Philosophie durchaus in so einer Art Abgrenzung zu einer bestimmten Form kontinentaler Philosophie an sich besteht – mit dem Gestus: ‚Das kann man auch alles klar und deutlich sagen, denn in der Philosophie geht es um einen regelgerechten Gebrauch des Denkens‛. Damit ist im Grunde bereits eine Art ‚Kompetenzorientierung‛ in die DNA der analytischen Philosophie eingeschrieben, die es den Analytiker:innen viel leichter macht, zu sagen, dass im Philosophiestudium bestimmte Kompetenzen erworben werden müssen, nämlich der regelgerechte Gebrauch des eigenen Denkens. Das heißt vor allem, richtig zu argumentieren – Philosophie als Technik sozusagen. Und der Erwerb von Techniken ist vermeintlich sozial neutral. Soweit man intelligent genug ist, kann man auch diese Techniken erwerben. Das ist, glaube ich, sozusagen die offizielle Story.
Aber man sieht natürlich auch, dass die analytische Philosophie sich ein bisschen davon wegbewegt hat. Um in der analytischen Philosophie zu reüssieren und damit Positionen innerhalb des deutschen Hochschulsystems zu ergattern, werden Auslandsaufenthalte an englischen und amerikanischen Universitäten vorausgesetzt. Damit kommt soziales Kapital, aber auch ökonomisches Kapital wieder durch die Hintertür rein. Zwar scheint die analytische Philosophie als Ausbildungsweg demokratischer zu sein, als die kontinentale Philosophie; im Endeffekt erfüllt sie aber die gleiche Funktion wie die kontinentale Philosophie, nämlich bestimmte Leute in die Positionen hineinzubringen, die dann das Fach vertreten.
Das Thema Klassismus – d. i. die Barrieren, die Erstakademiker:innen zu überwinden haben, wenn sie Philosophie studieren – kann man einmal über diesen analytisch-kontinentalen Split betrachten, aber genauso gut mit der Differenz zwischen materialistischer und idealistischer Philosophie. Zum Beispiel zeugen solche Argumente, dass man, um überhaupt sinnvoll Philosophie studieren zu können, Altgriechisch können müsse, weil Philosophie seit 2000 Jahren immer über die gleichen Probleme nachdenkt, die eben ursprünglich auf Altgriechisch formuliert wurden, derlei Argumente zeugen von einer bestimmten idealistischen Philosophieverständnis, das so reich an Voraussetzungen bezüglich der Bildungsbiografien ist, dass man das schwierig ohne Klassismus denken kann. Natürlich ist es jetzt nichts Neues, dass man sagt, idealistische Philosophie sei bürgerliche Ideologieproduktion und wir müssten diese Art des Denkens – wie Marx schon gegen Hegel behauptete und was Althusser hundert Jahre später wieder aufgewärmt hat – überwinden. Aber diese Sachen wurden nicht umsonst gesagt: Wenn man materialistisch philosophiert, muss man die Praxis des Philosophierens selber reflektieren und ändern. Vor diesem Hintergrund würde man zum Beispiel über Euch sagen: Die Prager Gruppe* ist ein materialistisches Projekt, sofern sie versucht, andere Wege des Philosophierens zu etablieren. An Universitäten ist das nicht so leicht, weil die institutionellen Formen bereits auf eine idealistische Vermittlung angelegt sind.
Womit ich zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht habe, ist, mehr mit dem Medium Film zu philosophieren; das heißt, theoretische Texte und deren Inhalt mit Filmen zu rahmen oder Filme so auszuwählen, dass sich theoretische Inhalte darin spiegeln und benutzt werden können zur Interpretation dieser Filme. Das hat gut funktioniert. Dadurch wird Theorie ganz anders nochmal gelesen und fruchtbar, weil die Studierenden merken – ‚Okay, wow!‛ – das hat irgendwie was mit dem zu tun, was sie wirklich beziehungsweise was sie an dem Film beschäftigt, mit dem sie sich wiederum identifizieren können. Also dieses sehr klassische, textbasierte Unterrichten in der Philosophie ist, glaube ich, etwas, wo man dran rütteln muss, wenn man den Zugang zum Philosophiestudium – und es geht ja wirklich erstmal überhaupt um den Zugang – öffnen will. Man kann nicht im ersten Semester gleich von Leuten verlangen, Kants Kritik der Urheilskraft zu lesen. Außer man will halt systematisch hohe Abbrecherquoten produzieren. Aber auch das kann ja sein.
PG*: Das sind in gewisser Weise zwei verschiedene Punkte. Auf der einen Seite das materialistische Philosophieren, was ja durchaus nicht einfach nur etwas für Leute in der Studieneingangsphase ist. Das andere ist eine andere Form von Praxis des Philosophierens, die Leute dazu bringt, sich einen Weg in diese Institution zu bahnen. Oder ist das nur eine Reihung?
Dr. BR: Ich hätte jetzt den Faden aufgenommen und würde sagen: Eine materialistische Art und Weise zu Philosophieren ist für die Aufnahme eines Studiums durchaus geeignet, weil die materialistische Art und Weise des Philosophierens etwas mit dem Leben zu tun hat, das die Studierenden führen, weshalb die philosophische Praxis etwas sein muss, was nicht nur im Seminarraum in der Universität als ein Inhalt, oder als eine Technik, oder als eine Kompetenz wahrgenommen wird, sondern als etwas, das etwas mit dem eigenen Wahrnehmen und Denken und Reflektieren macht. Jedenfalls ist das Grundbestandteil meines Philosophieverständnisses; aber ich würde sagen, das ist jetzt auch kein besonders originelles. Viele würden vermutlich sagen: ‚Erkenne dich selbst!‛ sei eines der Leitmotive, worum es beim Philosophieren geht, und: ‚Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen‛, ein anderes. Es geht darum, Leute dazu zu befähigen, mit ihrem Denken so flexibel zu werden, dass sie ihre Wahrnehmungs- und Denkweise sowie ihre Denkschemata selbstkritisch reflektieren und ins Verhältnis setzen können zu anderen Wahrnehmungsweisen, Reflexionsmodi und so weiter.
All das sind Dinge, die man im eigenen Denken erfahren muss. Und solche Erfahrungen zu produzieren, erreicht man über eine materialistische Art und Weise des Philosophierens. Das ist eine Weise, die nicht nur im Seminarraum, nicht nur als Lerninhalt und nicht nur als Fach, sondern irgendwie darüber hinaus einen Überschuss produziert, den man nicht mehr loswird. Im Prinzip ist das die große Herausforderung beim Philosophieunterricht, solche Erfahrungsräume zu inszenieren oder zu ermöglichen. Das setzt ein bestimmtes Lehrverständnis voraus. Und zwar, dass man nicht der Hüter der Wahrheit oder derjenige ist, der wirklich richtig denken kann und die anderen können es noch nicht. Es geht darum, die „Gleichheit der Intelligenzen“ zu simulieren und damit Leute zu befähigen, sich selber als ein Wesen zu verstehen, das berechtigt ist, im philosophischen Orchester mit einzustimmen. Häufig erlebe ich bei Studierenden die Blockade, wobei sie sich selber nicht für berechtigt halten, eine eigene philosophische Position zu beziehen, weil Philosophie als das erscheint, was Professor:innen machen, also nichts, wozu man selber eine Stimmberechtigung hat.
PG*: Hast Du das Gefühl, dass Dir das, was Du mit dem Mentoring vorhast, gelingt? Und wenn ja, wie? Gibt es Beispiele?
Dr. BR: Eine bestimmte Art von Governance an Universitäten hätte gerne, dass man die Wirkung von solchen Interventionen quantitativ messen kann. Damit gehen bestimmte Fantasien einher, zum Beispiel, dass man Erstsemester systematisch testet, dann bestimmte Sachen feststellt, anschließend interveniert und dann wieder testet; alles in der Hoffnung, dass sie im Anschluss auf dem Papier besser sind als vorher. – Dergestalt über die Sache nachzudenken oder eine Problembeschreibung anzufertigen, hat einen kognitiven Bias, in dem im Grunde ein klassistischer Bias enthalten ist. Die Perspektive, die ich mittels der Habitus-Struktur-Konflikte auf die Studieneingangsphase habe, steht vor dem Problem, dass man die Effekte entsprechender Interventionen nur mittels qualitativer Methoden und über einen längeren Zeitraum messen kann. Die sind zeit- und voraussetzungsreich und bewirken auch etwas in dem Subjekt, wenn es anfängt, anders über sich nachzudenken, als es das gewohnt ist.
Deshalb ist total wichtig, dass man die verschiedenen Wahrnehmungen von Wissenschaft und die damit verknüpften Wertungen aktiv zu Bewusstsein sich holt und als Ressource nutzt, um sich auch selbst besser zu verstehen – warum man so, warum man überhaupt und wie man studiert. Die Leute sind ja auch nicht doof, natürlich reagieren die mit widerständigen Praktiken auf klassistische Situationen oder auf klassistische Phänomene. Die sagen sich dann halt; ‚Wenn Du mich so behandelst, behandle ich die Institution auch so!‛. Keiner darf sich wundern, wenn Studierende das klassistische Spiel nicht mitspielen und sagen: ‚Nein, nicht die Wagner-Opern sind das Größte in der Welt, sondern K-Pop!‛. Es ist eben so, wie Bourdieu sagt: der Klassenkampf spielt sich auf der Ebene der Klassifikation ab. Dabei geht es darum, was und wie bewertet wird und wer die Hegemonie in diese Klassifikationsschemata hineinlegt. Die Universität ist dabei einer der Orte, wo sehr stark bestimmt wird, was als legitime Kultur gilt. Natürlich fragen sich dann Studierenden, ob das hier ein Raum ist, in dem sie mit ihren Wahrnehmungen und ihren Bewertungen von sozialer Wirklichkeit gesehen werden und auf der gleichen Wellenlänge liegen oder nicht? Wenn sie dann Professor:innen erleben, die irgendwie out-of-space sind und von Sachen reden, die gar nichts mit ihnen und ihrer Weltwahrnehmung zu tun hat, kann es schnell zu Solidarisierung zwischen den Studierenden kommen, die sich dann wechselseitig darin bestätigen, die Universität doof zu finden oder als Institution abzulehnen. Diese Prozesse sind dermaßen kompliziert und komplex, dass man nur schließen kann, dass es wichtig ist, an dieser Stelle zu intervenieren, wenn man eine gerechtere Universität, eine „Universität der Vielen“ im Blick hat. Studierende am Anfang des Studiums einfach nur zu testen und sie nachzuschulen, unterschätzt, was Universität als gesellschaftlicher Raum ist und was dort passiert und stattfindet. – Das war mir persönlich vorher auch nicht so klar. Ich habe einfach die Universität besucht und mir gedacht; ‚Super, hier kann ich viel machen und studieren, und kann die ganze Zeit lesen und so…‛. Ich habe mich wie so ein Fisch im Wasser gefühlt. Aber mir fällt jetzt auf, dass mein Studierverständnis und Studierverhalten stark von ‚ignorance‛ gegenüber bestimmten Realitäten geprägt war.
PG*: Erfährst Du für deinen Ansatz und deine Methode Gegenwind? Gibt es ‚alte, weiße Männer‛, die unsterblich in ihr Altgriechisch verliebt sind und es einfach total doof finden, was Du da machst, weil sie meinen, dass manche Leute einfach nicht an die Uni und schon gar nicht in die Philosophie gehören?
Dr. BR: Nein, so richtig Gegenwind erfahre ich nicht. Ich habe schon den Eindruck – und deswegen benutze ich den Klassismusbegriff auch in bestimmten kommunikativen Zusammenhängen nicht –, dass man den Klassenkampf jetzt nicht so offen in die Universitäten tragen kann, sondern eine Deckterminologie benötigt. Diese First-Gen-Terminologie eignet sich gut, um Klassenphänomene auf eine Weise thematisieren zu können, die erstmal unverdächtig daherkommt. Mit was ich eher konfrontiert bin, ist mangelnde Unterstützung. Man muss sich die Alliierten schon aktiv suchen und dabei die anderen Benachteiligungsdimensionen, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus etc. im Blick behalten und sie nicht gegeneinander ausspielen.
PG*_ Neben der Selbsterkenntnis und dem mündigen Verstandesgebrauch hast Du im Vorgespräch das Staunen als den dritten wichtigen Punkt deines Philosophieverständnisses genannt. Was ist in Bezug auf die Habitus-Struktur-Konflikte, zugespitzt gesagt, in diesem Staunen an sozialem Konfliktpotenzial drin? Was wird da sichtbar?
Dr. BR: Ich glaube, auch das Staunen darf man nicht naiv verstehen, im Sinne von, ‚die einen haben es, die anderen haben es nicht‛. Auch im Staunen steckt eine Klassifikation, nämlich die normative Bewertung, wonach Staunen etwas Gutes ist, was ja nahe an der normativen Bewertung liegt, wonach Kontemplation im Gegensatz zu körperlicher Arbeit etwas Gutes ist. Beide führen letztlich zu einer normativen Einstellung zur Zeit und zum Gebrauch der eigenen Lebenszeit. Kommt man aus einem Herkunftsmilieu, wo die Maxime herrscht, Zeit produktiv zu nutzen und nicht seine Lebenszeit zu verschwenden, wird man auch eine Ablehnung gegen das Staunen haben, weil es Lebenszeit von der Uhr nimmt, die nicht produktiv verwendet werden kann. Das hat viel mit einem Arbeits- und mit dem Mußeverständnis zu tun und ist ganz tief affektiv in einem verankert. Deshalb ist es schwer, bestimmte evaluative Muster zu durchbrechen, wenn man die in seinem Habitus einmal aufgenommen hat. Dann kann man sich den Appell, jetzt mal zu staunen im Grunde aber auch sparen, weil es keine Willensentscheidung ist. Wenn ich vom großen Anderen [ein Begriff von Lacan, PG*] Anerkennung für handfeste Resultate bekomme, hilft ja die Aufforderung zu staunen, nichts.
PG*: Aber das emanzipative Moment wäre ja trotzdem das, den Studierenden aufzuzeigen, dass es dann doch etwas Gutes ist oder sein kann, sich diese Lebenszeit und Muße zu nehmen, um sich tatsächlich mit Themen zu beschäftigen, die einen ‚einfach so‛ (ohne unmittelbaren ökonomischen Nutzen) interessiert. Es kann ja nicht darum gehen, Staunen und Muße an sich abzutun und die Studierenden im gewohnten Habitus zu halten.
Dr. BR: Nein, nein, es geht nur darum, dass man bestimmte Impulse nicht dadurch setzen kann, dass man es sagt. Wir müssten mal eine Philosophie des Wartens in einem Seminar anbieten, dann machen wir mal 90 Minuten nichts außer warten und halten das mal aus.
PG*: Damit wären wir wieder bei der Frage nach der Methode. Wie Du sagst, kann es beim Mentoring nicht darum gehen, formale Aufforderung zum Beispiel zum Mußegenuss zu geben, sondern darum, den Studierenden zu helfen, von selbst in eine gewisse Haltung oder Gewohnheit reinzuwachsen, aus der heraus es ihnen möglich wird, diese reale Option als eine realistische zu empfinden, das Staunen nicht als verschwendete Lebenszeit, sondern als etwas Wertvolles. Aber allein zum Aphorismen-Schreiben, wie Du es mal in einem Seminar angeboten hast, wird man eine Art Muße brauchen.
Dr. BR: Genau. Aber zwei Punkte dazu: Der eine Punkt ist, sich das überhaupt erst mal bewusst zu machen; das ist schon total viel wert und wichtig. Lars Schmidt in Düsseldorf hat viel zu Habitus-Transformationen gearbeitet und mit seinen Studierenden Sozioanalysen gemacht, bei denen man sich aus der dritten Person und als Teil des Gesellschaftszusammenhangs beschreibt, dadurch erlangt man einen Außenblick auf sich selber und die eigenen Alltagspraktiken. Aber dieses sich selber aus der dritten Person sehen lernen, und die soziale Bedingtheit des eigenen Tuns, Wahrnehmens, Reflektierens und Denkens erkennen, ist der erste Schritt. Die andere Dimension ist, selber diese Praktiken als Praktiken zu machen, also wirklich mal zu staunen. Ich hatte auch ein Seminar zur solidarischen Ökonomie, wo die Studierenden zu solidarisch-ökonomischen Akteuren aus Berlin hingegangen sind und sich die Sache angeguckt haben. Die mussten nachher Porträts schreiben. Die Idee war, dass das sozialphilosophische Inventar an Begriffen ja auch irgendwie zur Wirklichkeit passen muss. Deswegen haben wir erst die Begriffe entwickelt, dann sind die rausgegangen, haben mit den Akteuren gesprochen, haben es wieder korrigiert und so weiter. Solche Sachen bringen einem total viel fürs eigene Verhältnis zur Wissenschaftlichkeit.
PG*: Um auf ein Thema von vorhin zurückzukommen: Freilich ist es klassistisch, wenn sich permanent darüber beschwert wird, dass die Leute von heute nur noch ins Handy starren und keiner mehr ordentlich, gern und viel liest. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass, wenn man aus einem Milieu kommt, wo halt eher Fernsehen geguckt wird, lange und komplexe Texte tatsächlich erstmal ein unglaublicher Kraftakt sind, der nicht so einfach von der Hand geht. Sofern man sich dann in ein Philosophiestudium richtig reingehängt, ist es ein sehr schmerzhafter Kraftakt, sich diese anderen Kulturtechniken als neue Gewohnheit beizubringen. Bourdieu soll irgendwo auch gesagt haben, dass es 20 bis 25 Jahre dauert, den Standardkanon nachzulernen, wenn man ihn nicht mit in die Wiege gelegt bekommen und erst spät mit dessen Aneignung angefangen hat. Kurz, die Kritik, dass Leute im Vergleich zu früher nur noch auf Bildschirme starren und weniger Lust haben oder fähig zum Lesen langer Texte sind, ist, trotz des darin einbegriffenen Klassismus, nicht ganz unwahr. In gewissen Milieus, gerade solchen denen First-Gens oft entstammen, wird zu Hause nicht die griechische Mythologie zum Einschlafen vorgelesen, sondern Galileo geschaut; es ist einfach nicht üblich und später enorm kräftezehrend, sich in diesen ‚Standard‛ hineinzuleben. Wie geht man damit um?
Dr. BR: Ja, deswegen biete ich auch eine Seminarreihe an, wo wir wirklich gemeinsam lesen, und zwar Satz für Satz und Reihe um. Im Grunde die Simulation eines Lesekreises. Mitdenken muss man an dieser Stelle, dass Vieles von dem, was an Enkulturation während des Studiums passiert, außerhalb der Institution Universität stattfindet. Philosophisches Diskutieren lernt man nach dem Tutorium abends am Kneipentisch mit den Kommiliton:innen, zumindesten wenn man in der Studentenstadt wohnt und nicht wegpendeln muss. Lesen enkulturiert man in Lesekreisen, wo man stundenlang in Marx’ Kapital liest und sich fragt, ob man das verstanden hat. Das heißt: Vieles von dem, was Universität vorgibt zu leisten, leistet Universität gar nicht selber, sondern passiert in außeruniversitären Räumen, vorausgesetzt die Studierendenschaft ist so strukturiert, dass sie diese außeruniversitären Räume stiftet.
Wenn man aber zum Beispiel wie ich, an einer Pendleruniversität arbeitet, wo viele Studierende auch noch selber erwerbstätig sind, kann man nicht erwarten oder gar verlangen, dass die sich abends treffen, um fünf Stunden das Kapital querzulesen. Das heißt, man muss curricular anbieten, was sonst außerhalb des Curriculums stattfindet. Von D.E. Smith gibt es tolle Analysen, wie viel Schule davon lebt, dass Mütter zu Hause bestimmte Enkulturationsleistungen für ihre Kinder bereitstellen, die für den Schulerfolg relevant sind; zum Beispiel Lesen lernen. Dafür braucht es aber eine Mutter, die nicht acht Stunden Arbeit oder gar Schichtarbeit macht, und die sich mit dem Kind hinsetzt und liest. Universität lebt auch von Enkulturationsleistungen, die sie nicht selbst vermittelt. Darüber zu schweigen ist Teil der Bildungsungerechtigkeit und ihrer Reproduktion. In diesen Zusammenhang fällt auch die Frage der Anwesenheitspflicht: muss man sie haben, ja oder nein? Lustigerweise sind es immer die bürgerlichen Student:innen, die gegen die Anwesenheitspflicht politisch argumentieren. Aus einer habitustheoretisch informierten Perspektive muss man sich jedoch klar für die Anwesenheitspflicht aussprechen. Wie soll ich den Leuten dabei helfen, ein belastbares Verhältnis zum Studium aufzubauen, wenn sie nicht da sind? Ohne Anwesenheitspflicht ist völlig klar, wem von den Studierenden es gelingt, zu Ende zu studieren und wem nicht.
PG*: Nochmal zum Staunen. Diese Art und Weise der Kontemplation, diese Art und sich hinzusetzen, ein Buch zu lesen und über Sachen nachzudenken, hat auch etwas mit einer gewissen Aufgabe von Selbstbehauptung zu tun, es ist keine Abgeklärtheit, die da vorausgesetzt wird, keine Toughness. Die Behauptung innerhalb einer sozialen Ordnung wird nicht durch Kontemplation erreicht. Für die Durchsetzung an der Akademie hat das Staunen einen relativ geringen Wert, sonst würden ja nicht so viele schlechte Paper über 15 Seiten produziert werden, wo letzten Endes nichts drinsteht. Um sich in Academia durchzusetzen, muss man eher auf das Staunen verzichten und lieber mal Drittmittel organisieren.
Dr. BR: Da würde ich völlig zustimmen. Die drei Motive, die ich genannt habe, beschreiben nicht unbedingt das Selbstverständnisse akademischer Philosophierender. Dort herrscht Konformitätsdruck durch bestimmte Faktoren wie Peer-Review-Verfahren und so weiter. Man benutzt weniger seinen eigenen Verstand, sondern den in der Scientific Community anerkannten Verstand. Man produziert Paper nach einer bestimmten Form, damit sie publiziert werden, und man will, dass sie publiziert werden, weil man sonst Reputationsverlust erleidet. Auch das Erkenne-Dich-Selbst-Motiv in Form eines selbstkritischen Bewusstseins ist kein Leitmotiv für professionell Philosophierende. Gerade die Habitus-Sensibilität ist zum Beispiel meiner Erfahrung nach äußerst gering ausgebildet bei Philosophie-Lehrenden, ein klassistisches Beispiel hierfür ist das beim Konferenzdinner beliebte Thema: Winter-Urlaub. Wenn von Skigebieten und Pisten gefachsimpelt wird, dann ist klar, wer sich da wohl und wer sich da unwohl fühlt. Erkenne-dich-selbst ist keine Leitmaxime für erfolgreiche Karrieren. Dasselbe gilt fürs Stauen. Wenn man in dem Betrieb betriebsam sein will, sollte man seine Zeit nicht mit Staunen verschwenden. Diese drei Leitmaximen stellen für mich tatsächlich eher Impulse für die Studieneingangsphase dar, um Leute überhaupt erstmal in einen philosophischen Modus hineinzukriegen.
PG*: Um mit diesem Resultat nochmal den Bogen zur Unterscheidung zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie zu spannen. Die analytische Philosophie ist doch deutlich stärker im postheroischen Zeitalter angekommen als kontinentale. Es gibt so etwas wie Arbeitsteilung in der analytischen Philosophie; in der kontinentalen gibt es das in der Art nicht – die geht tendenziell aufs Ganze, den Universalgelehrten, der seine eigene Theorie hat, wo er die Sachen einordnen kann, fertig. Dieser gilt dann aus sich heraus als Person samt seiner Philosophie als wertvoll. In der analytischen Philosophie teilt sich das klar in Teilbereiche, gemeinsame Paper oder so weiter. Damit bildet sich natürlich auch eine Form von Spezialisierung heraus sowie ein Verfahren, das ich mir handwerklich eher aneignen kann. Ist dieser Weg der demokratischere sowie derjenige, der besser zum System Universität passt? Gleichzeitig brauchen wir, wie Du es beschreibst, in der Studieneingangsphase allerdingsa uch dieses ich-bezogenen Momente der persönlichen Erfahrung vom Philosophieren. Wie verhält sich das und wo sind da die Probleme? Ist es ein Entweder-Oder, oder kriegt man das vereint? Müssten wir in der Studieneingangsphase jetzt weniger kontinentale Philosophie betreiben und alle Analytiker werden; brauchen wir dann überhaupt noch kontinentale Philosophie? Passt das mit dem Hochschulsystem zusammen oder wird das Hochschulsystem nur umso klassistischer, je mehr kontinentale Philosophie wir treiben?
Dr. BR: Ich glaube, damit ist analytische Philosophie und ihre Praxis richtig beschrieben. Was dort teilweise sprachlich verschriftlicht wird, kann in Zukunft auch von künstlicher Intelligenz verrichtet werden, da die Formalisierung von Argumentationsmustern, die Formalisierung von sprachlichen Äußerungen etwas ist, was ersetzbar wird. Bei vielen Papern ist auch egal, wer sie geschrieben hat, da sie immer nach dem gleichen Baukastenprinzip gebaut sind. Das kann im Grunde auch eine KI machen, weil es einfach eine sehr formalisierte Anwendung von Sprache ist.
Die kontinentale Philosophie ist meines Erachtens deswegen klassistisch, weil sie häufig von Referenzen auf kulturelle Größen lebt, die nicht von jedem erkannt, gewusst oder sonst was werden; das ist die inhaltlichen Ebene. Auf einer anderen Ebene ist da der Professor als bewunderungswürdige Gestalt, oder als Universalgelehrter. Ich habe im letzten Semester ein Leseseminar zum Thema Bewunderung gemacht: wen bewundern wir, warum und wieso? Mir scheint nämlich, dass Universität und Enkulturationsprozesse viel damit zu tun haben, was Universität als bewunderungswürdig ausstellt. Auf einem Campus wie an der Humboldt Universität oder in Freiburg wird man auf Figuren, Statuen, Bilder, Fotografien von weißen Männern mit wenig Haaren stoßen, die die Studierenden (im althusserischen Sinne) anrufen, sie zu bewundern, weil sie Wissenschaftler sind. Völlig klar ist, dass bestimmte Subjekte diese Anrufung affirmativ annehmen und annehmen können, Jünglinge, die glauben, sie werden the next Heidegger oder so. Und es gibt natürlich Subjekte, die nicht weiß, nicht männlich, nicht bürgerlich sind, und bei denen diese Anrufung auch eine Wirkung hat, aber eine gegenteilige in dem Sinne von: ‚Ich bin nicht so wie du, offensichtlich ist das hier nicht mein Raum‛.
Deswegen glaube ich, dass die Frage nach der Bewunderung eine kontroverse ist. Die eine Argumentationslinie sagt, dass man ein Vorbild braucht, an dem man sich orientieren kann, und dann strebt man dahin. Die andere Linie ist eine, die mit Fromm und seinem Konzept des autoritären Charakters arbeitet und sagt, Bewunderung ist eigentlich immer schlecht, weil es Subjekte in einen Unterwerfungszusammenhang hineinmanövriert und im Grunde nicht sehr demokratisch ist. Das wiederum eröffnet die Frage, ob Universität ohne Bewunderungsanrufung vorstellbar ist oder zumindest plurale Anrufungen ermöglichen müsste?
PG*: Würdest Du sagen, dass das ein Spezifikum der Philosophie ist?
Dr. BR: Ja, das Bewunderungsphänomen ist ein Spezifikum der Philosophie. Das ist in den Naturwissenschaften meines Erachtens nicht so stark ausgeprägt.
PG*: Jetzt mal ganz zugespitzt gesagt: Wieviel Demokratisierung kann sich eine Philosophie leisten, die sich noch irgendwie kontinental versteht? Die Lösung scheint in der Praxis und nicht in der Theorie zu liegen. Aber wenn wir sagen, wir machen Arbeitsteilung und Spezialisierung innerhalb der Philosophie, wir sorgen dafür, dass Leute sich auf Protokollsatz spezialisieren, Latein und Altgriechisch nicht mehr zwingend notwendig sind, wir nur noch Paper über 15 Seiten schreiben, wo aber nichts drinsteht, scheint das auch nicht der Weg zu sein. Wie kriegen wir es hin, Philosophie mit einem gewissen Pathos aufrechtzuerhalten, den wir wohl alle nicht missen wollen würden; wie kriegen wir es hin, Leuten darzulegen, wie großartig Philosophie eigentlich ist?
Dr. BR: Man muss es halt irgendwie hinbekommen, dass die Leute die Philosophie großartig finden… Aber das ist auch deshalb schwierig, weil Philosophie eine Desorientierungs-, Desubjektivierungs-, Desidentifikations-, Verunsicherungsdisziplin ist. Nicht alle müssen dafür eine Leidenschaft haben. Aber zur Ausgangsfrage – Kontinentale Philosophie: Ich glaube, ich würde die Frage der Demokratiesierung nicht über den Split kontinental vs. analytisch führen. Für mich stellt sich eher die Frage, was macht Philosophie demokratisch? Philosophie ist eine demokratische Praxis, weil sie ermöglicht, Begriffe, die man verwendet, um sich und die Welt, in der man lebt, zu verstehen, kritisch weiterzuentwickeln und ins Verhältnis zu setzen mit alternativen Begrifflichkeiten und Begriffsmustern. Ich würde mit Hegel behaupten, Begriffe sind das, was unsere Wahrnehmung strukturiert. Deshalb ist die Arbeit an den Begriffen auch wichtig fürs Zusammenleben. Ferner würde ich behaupten, ungerechte, ungleiche Gesellschaften assen sich über so einen Mechanismus beschreiben, der von Iris Young und feministischen Theoretiker:innen beschrieben worden ist: Unterdrückung besteht darin, dass man gezwungen ist, in Begriffen über sich und die Wirklichkeit nachzudenken, durch die man sich selber in der unterdrückten Position festschreibt. Damit kann man sich den Diskurs der Universität angucken, den sie über sich selber führt, und feststellen, dass das in Deutschland ein Diskurs ist, der mit den Begriffen Freiheit und Einsamkeit operiert. Das sind aber Begriffe, die super klassistisch aufgeladen sind, weil sie denjenigen ausschließen, die sich nicht als Student:in, als freies Wesen fühlen, sondern Orientierung suchen oder sich als Student:in vor der Einsamkeit am Schreibtisch fürchten, weil sie gar nicht wissen, was sie machen sollen. Der ideologische Diskurs der Universität bietet Begriffe an, die, wenn man sich mit ihnen reflektiert, einen dazu bringen, sich selber als unzureichendes Mitglied der Lebensform Universität wahrzunehmen, was meines Erachtens eine starke Form der hermeneutischen Ungerechtigkeit ist. Deswegen muss auf die begriffliche Reflexion und die Durchdringung von begrifflichen Zusammenhängen gesetzt und gefragt werden, was das mit einem selber zu tun hat. Das ist, finde ich, eine sehr demokratische Praxis.
PG*: Würdest Du die Thematik dann eher an der Verlaufslinie idealistisch-materialistisch, so wie Du es oben skizziert hast, einführen wollen?
Dr. BR: Ja, genau. Ich würde sagen, die demokratischere Praxis des Philosophierens ist die materialistische.
PG*: Nun sind aber Idealismus und Materialismus beide gleichermaßen Produkte der kontinentalen Philosophie.
Dr. BR: Wenn man es so zurückreflektieren will auf die kontinentale Philosophie, würde ich sagen, kontinentale Philosophie kann ihren Beitrag dazu leisten. Dann auch anders als analytische Philosophie; die mag zwar demokratischer erscheinen, führt ja aber letzten Endes zu Subjekten, die austauschbar gegeneinander sind, weil sie im Grunde alle dasselbe sagen müssten, wenn sie an derselben Stelle des Diskurses stünden.
PG*: Ist das nicht auch ein zentraler Unterschied zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie? Analytische Philosophie scheint alles in allem fungibler zu sein und ist vielleicht deswegen demokratischer, weil die Subjekte, die dort geformt und gebraucht werden, leichter und passgenauer integrierbar sind ins System der Arbeitsteilung usw., verglichen mit der kontinentalen Philosophie. Denn selbst wenn sie der Tendenz nach klassistisch ist, scheint kontinentale Philosophie ein größeres kritisches Potenzial zu haben als die analytische Philosophie.
Dr. BR: Die Unersetzbarkeit oder die Singularität oder sowas in der Art, ist, glaube ich, durch eine kontinentale Philosophie besser vermittelbar und auch in der kontinentalen Philosophie besser reflektiert als in der analytischen.
PG*: Was wiederum nicht zum Abbau von Hierarchien und Bewunderungsstrukturen beiträgt…
Dr. BR: Ja, man hängt halt so am Heroischen, am großen Einzelnen, fest.
PG*: Bastian, warum hast Du Philosophie studiert? Also wir wissen ja jetzt, dass Du Dich wie ein Fisch im Wasser gefühlt hast, aber wieso wolltest Du ein Fisch im Wasser sein?
Dr. BR: Weil ich in der Schule Philosophie (und Soziologie) toll fand und dort die Erfahrung gemacht habe, dass ich es mag, über theoretisch komplizierte Texte nachzudenken; aber auch, weil ich einen Distinktionsgewinn gegenüber Mitschüler:innen daraus zog, diese Texte verstehen und so komplizierte Wörter benutzen zu können wie ‚Hypostasieren‛ oder ‚Apotheose‛. Das hat auch etwas mit Bewunderung zu tun. Zum Beispiel die Bewunderung für Jean-Paul Sartre, für dessen Lebensentwurf und Lebensmodell, wo man denkt, er habe alles richtig gemacht. Das habe ich mit 16, 17, wo man beginnt, sich Entwürfe vom eigenen Leben zu kreieren, gedacht. In Freiburg fand ich dafür einen Resonanzraum, wo man in Freiheit und Einsamkeit in der Bibliothek sitzen und stundenlang Bücher exzerpieren konnte. . .
PG*: Hast Du eine Frage an die Prager Gruppe*?
Dr. BR: Versteht Ihr euch selber als eine materialistische Praxisform des Philosophierens?
PG*; Wir haben dieses Manifest geschrieben, worin steht, dass wir zusammen philosophieren würden. Ärgerlich war es dann, dass wir im vergangenen Jahr nur Orga- und Verwaltungskram gemacht und gerade nicht mehr so philosophiert haben, wie es im Manifest als Ideal geschrieben steht. Dabei ist die Gruppe entstanden aus einem sehr biermaterialistischen Grundmoment oder Grundgedanken heraus, wenn man so will. Nämlich waren wir, wie so oft, in Prag zusammen Bier trinken, diesmal in einer recht großen Runde, und haben wirklich viel und aktiv miteinander philosophiert, stundenlang wunderbare Gespräche geführt; das war eine dermaßen gute Erfahrung, dass wir an Ort und Stelle spontan entschieden haben, zusammen wegzufahren, um das vertiefen und noch mehr auskosten zu können. Vorgeschlagen wurde dann aus heiterem Himmel auch, ein Manifest zu schreiben – und plötzlich war die Prager Gruppe* da. Auch dieses erste große Treffen in Karlsbad, wo es gut zur Sache ging und einige soziale Irritationen entstanden sowie unerwartete Verhandlungsprozesse geführt wurden, könnte man als materialistisches Philosophieren titulieren. Vielleicht waren die der Grund, warum wir während des Konstitutionsprozesses irgendwann viel formalisiert haben, aber all das wurde irgendwann so bürokratisch, dass das letzte Jahr einfach wirklich ganz furchtbar leblos war und bei vielen Leuten eine Art Entfremdungseffekt aufgetreten ist, der sich auch erst wieder gelegt hat bei der letzten Fahrt im Sommer 2024. Geholfen hat wohl auch, dass wir zur gleichen Zeit unseren ersten öffentlichen Auftritt als Prager Gruppe* auf einem Festival hatten, wo wir Impulsvorträge gegeben und direkt vor Ort vis-á-vis mit Leuten philosophiert haben.
Die Zeit ist leider um. Vielen Dank, Bastian. Das war ein sehr schönes Gespräch!
Dr. BR: Gerne, danke Euch!